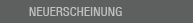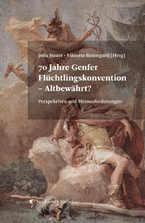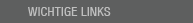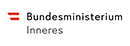Leitsätze
2951
Neuerlich zu Hinderungsgründen und anrechenbaren Prüfungen iZm dem Nachweis eines Studienerfolgs
Leitsätze
I. Nach der VwGH-Rsp kann von einem unabwendbaren oder unvorhersehbaren Hinderungsgrund iSd § 64 Abs 2 letzter Satz NAG nicht die Rede sein, wenn der Hinderungsgrund dauerhaft ist. Von einem dauerhaften Hindernis ist ua bei länger dauernden (im Allgemeinen die Dauer eines Jahres überschreitenden) Erkrankungen auszugehen. II. Der für die Verlängerung des studentischen Aufenthaltstitels erforderliche Studienerfolgsnachweis ist zu den vom Antragsteller betriebenen Studien in Bezug zu setzen. Der verlangte Studienerfolg muss also dem betriebenen Studium (zu dem ein Antragsteller zugelassen wurde) zurechenbar sein. Es sind nicht jegliche Prüfungen hinreichend, sondern es muss sich um Prüfungen handeln, die nach dem relevanten Curriculum abzulegen sind.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 23.10.2023
Aufbereitet am: 25.03.2024
2950
Persönliche Anhörung von Minderjährigen sowie Prüfung des Kindeswohls im Rahmen der Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen
Leitsätze
I. Bei Erlassung einer Rückkehrentscheidung ist nicht allein auf die privaten und familiären Interessen eines Minderjährigen abzustellen, sondern es kommt auch den öffentlichen Interessen an der Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme - insb gegen im Bundesgebiet aufhältige Fremde, denen nach für sie negativem Abschluss von Asylverfahren kein Aufenthaltsrecht mehr zukommt - maßgeblicher Stellenwert zu. II. In jüngeren Entscheidungen der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts wurde (implizit) davon ausgegangen, dass die Vernehmung Minderjähriger grundsätzlich zulässig ist. Von der grundsätzlich gegebenen Zulässigkeit der Vernehmung von Minderjährigen in einem gerichtlichen und behördlichen Verfahren als Zeugen geht, wie sich aus den in diversen Gesetzen dazu enthaltenen Normen ableiten lässt, auch der jeweils zuständige Gesetzgeber aus. III. Bei der Beurteilung, ob und gegebenenfalls in welcher Art und Weise dem Beweisantrag auf Vernehmung eines Minderjährigen nachgekommen oder von Amts wegen dessen Vernehmung angeordnet wird, ist zur Wahrung des Kindeswohls von der Behörde und dem Gericht unter Bedachtnahme auf die konkreten Umstände des Einzelfalls ein strenger Maßstab anzulegen.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 25.10.2023
Aufbereitet am: 22.03.2024
2949
Neue Umstände hinsichtlich einer möglichen Aufhebung eines Aufenthaltsverbots?
Leitsätze
I. Bei der Prüfung eines Antrags auf Aufhebung eines Aufenthaltsverbots nach § 69 Abs 2 FPG sind die nach der Verhängung des Aufenthaltsverbots eingetretenen, geänderten Umstände zu beachten. In diesem Zusammenhang kann die Rechtmäßigkeit des Bescheids betreffend die Verhängung des Aufenthaltsverbots jedoch nicht mehr überprüft werden. II. Bei der Aufhebung eines Aufenthaltsverbots nach § 69 Abs 2 FPG sind Veränderungen der maßgebenden Umstände (sowohl zugunsten als auch zu Lasten der fremden Person) zu berücksichtigen. Ein Gesinnungswandel und damit ein Wegfall oder eine wesentliche Minderung der von der fremden Person ausgehenden Gefährlichkeit während einer kurzen Zeitspanne (hier: unter zwei Jahren) ist nicht als Veränderung von maßgebenden Umständen zu qualifizieren.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 26.04.2023
Aufbereitet am: 21.03.2024
2948
Zum "unmittelbar vorangehenden rechtmäßigen Aufenthalt" iSd § 45 Abs 2 NAG
Leitsätze
Im Fall eines rechtzeitigen Verlängerungsantrags ist einem Fremden bis zur Entscheidung über diesen Verlängerungsantrag dieselbe Rechtsposition eingeräumt, die er nach dem Inhalt des letzten Aufenthaltstitels innehatte. Das durch die rechtswirksame Erteilung eines Aufenthaltstitels erlangte Aufenthaltsrecht ist somit während des Verfahrens über den Verlängerungsantrag perpetuiert. Der Fremde stellte rechtzeitig einen Antrag auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung als Student. Dieser Antrag wurde erst im Beschwerdeweg mit Erkenntnis des VwG rechtskräftig abgewiesen. Bis zu diesem Zeitpunkt war daher das durch die rechtswirksame Erteilung der Aufenthaltsbewilligung als Student erlangte Aufenthaltsrecht perpetuiert. Der Zeitraum, in dem der Fremde aufgrund einer Aufenthaltsbewilligung nach § 8 Abs 1 Z 12 NAG im Bundesgebiet aufhältig war, erweist sich damit als der vom VwG angenommenen Niederlassung des Fremden als "unmittelbar vorangegangen" iSd § 45 Abs 2 NAG.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 18.10.2023
Aufbereitet am: 20.03.2024
2947
Unvertretbare Interessenabwägung iZm annähernd zehnjährigem Inlandsaufenthalt
Leitsätze
I. Die Rsp des VwGH zur besonderen Bedeutung eines (mehr als) zehnjährigen Inhaltsaufenthalts wurde vom Gerichtshof wiederholt auch auf Fälle übertragen, in denen die Aufenthaltsdauer knapp unter zehn Jahren lag. II. Die Fremde ist unbescholten, verfügt über sehr gute Deutschkenntnisse, hat enge Beziehungen zu ihrem niederlassungsberechtigten Ehemann sowie zu Freunden und Bekannten aufgebaut und sich durch Nebenbeschäftigungen während des Studiums integriert. Angesichts dieser integrationsbegründenden Umstände iVm dem langjährigen (neuneinhalb Jahre) - überwiegend rechtmäßigen - Inlandsaufenthalt ist die Auffassung des VwG, dass die im Rahmen des § 21 Abs 3 Z 2 bzw des § 11 Abs 3 NAG vorzunehmende Interessenabwägung zulasten der Fremden auszugehen hat, nicht zu teilen.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 05.10.2023
Aufbereitet am: 19.03.2024
2946
Einsatz für die Selbstbestimmung der Frau im von den Taliban kontrollierten Afghanistan
Leitsätze
I. Für den Konventionsgrund der politischen Überzeugung genügt es, wenn diese von den verfolgenden Akteuren zumindest unterstellt wird. II. Im patriarchalen Herrschaftssystem der Taliban ist davon auszugehen, dass jedermann, der sich für die Selbstbestimmung einer Frau einsetzt, Verfolgung wegen unterstellter politischer Gesinnung droht. Antragstellern, die ein solches Fluchtvorbringen glaubhaft machen, ist sohin der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen (§ 3 Abs 1 AsylG).
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 02.11.2023
Aufbereitet am: 18.03.2024
2945
Reisebeschränkungen anlässlich COVID-19 vor dem Hintergrund der Freizügigkeit und des Schengener Grenzkodex
Leitsätze
I. Die RL 2004/38/EG (Unionsbürger-RL) regelt das Ausreiserecht nicht nur für andere Unionsbürger, sondern auch für die Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaats, während sie in Hinblick auf das Einreiserecht bloß Regelungen für andere Unionsbürger enthält. II. Beschränkungen der Freizügigkeit, konkret des Ausreise- und des Einreiserechts (Art 4 und 5 RL 2004/38/EG) sind bereits in Maßnahmen zu erblicken, welche die Ausübung der Rechte weniger attraktiv machen. Zu nennen sind etwa auch Verpflichtungen, sich bei der Einreise zur Eindämmung von COVID-19 Screeningtests oder Quarantänen zu unterziehen. III. Beschränkungen dieser Rechte zum Schutz der Gesundheit (Art 27 Abs 1 und Art 29 Abs 1 RL 2004/38/EG) dürfen nicht wirtschaftlich motiviert sein und nur aus Anlass einer übertragbaren Krankheit ergehen. IV. Weder Art 27 Abs 1 noch Art 29 Abs 1 RL 2004/38/EG steht dem Gebrauch allgemein geltender Rechtsatzformen (in Österreich: Verordnungen iSd Art 18 Abs 2 B-VG) für Beschränkungen der Freizügigkeit entgegen. Auch mittels solcher Rechtsakte verfügte Beschränkungen müssen sich auf Rechtfertigungsebene an den Art 30 bis 32 RL 2004/38/EG messen lassen. V. Den genannten Art 30 bis 32 RL 2004/38/EG ist neben einer staatsgerichteten Pflicht zur Determinierung und Begründung der Maßnahme sowie der Garantie eines Rechtswegs auch ein Verhältnismäßigkeitsgebot zu entnehmen. VI. Die Freizügigkeit beschränkende Rechtsakte mit allgemeiner Geltung müssen neben dem amtlichen Kundmachungsmedium über eine amtliche mediale Verlautbarung in der Weise mitgeteilt werden (leicht zugänglich und kostenlos), dass Inhalt und Wirkungen des Rechtsakts, die Begründung sowie Rechtsbehelfe und Fristen zu deren Erhebung konkret genannt werden (vgl Art 30 Abs 1 und 2 RL 2004/38/EG). VII. Der Rechtsbehelf gegen den Rechtsakt muss wenigstens in Form einer inzidenten Bestreitung der Rechtmäßigkeit anlässlich einer Rechtsstreits, in dem er präjudiziell ist, bestehen (vgl Art 31 RL 2004/38/EG; vgl in Österreich die Möglichkeit der direkten Bekämpfung von COVID-19-Verordnungen anlässlich gerichtlicher Verfahren gemäß Art 144 Abs 1 oder Art 139 Abs 1 Z 4 B-VG). VIII. Dass andere Mitgliedstaaten eine übertragbare Krankheit mit weniger einschneidenden Mitteln bekämpfen, spricht nicht per se gegen die Verhältnismäßigkeit von Beschränkungen. IX. Die Mitgliedstaaten müssen, wenn sie beschränkende Maßnahmen aus Gründen der öffentlichen Gesundheit erlassen, in der Lage sein, geeignete Beweise beizubringen, um darzulegen, dass sie tatsächlich eine Untersuchung zur Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der fraglichen Maßnahmen durchgeführt haben, und alle sonstigen Nachweise zu erbringen, die ihre Argumentation stützen können. Eine solche Beweislast darf allerdings nicht so weit gehen, dass die zuständigen nationalen Behörden positiv belegen müssten, dass sich das legitime Ziel mit keiner anderen vorstellbaren Maßnahme unter den gleichen Bedingungen erreichen ließe. X. Bei der Eignungsprüfung ist auch das Vorliegen hinreichender Daten zum Zeitpunkt der Erlassung der Maßnahme zu prüfen. XI. Bei der Erforderlichkeitsprüfung ist zu berücksichtigen, ob für die Berechtigten wesentliche Reisen erleichtert werden. Das im Gesundheitsschutz anerkannte Vorsorgeprinzip erweitert den Beurteilungsspielraum der Mitgliedstaaten. XII. Bei der Adäquanzprüfung (Abwägung des Ziels der Verhinderung der Überlastung der Gesundheitssysteme durch COVID-19 insb mit Art 7 und 16 GRC) ist auch zu würdigen, dass die Ausreiseverbote aufgehoben werden, sobald der Zielmitgliedstaat auf der Grundlage einer regelmäßigen Neubewertung seiner Lage nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft wird. XIII. Bei der Prüfung, ob eine gegen COVID-19 gerichtete Maßnahme verbotenen Grenzkontrollen iSd Art 23 VO (EU) 2016/399 gleichkommt, sind die folgenden Gesichtspunkte zu berücksichtigen: Lediglich stichprobenartiger Charakter von Kontrollen, Hauptzwecke der Pandemiebekämpfung und nicht der Bekämpfung rechtswidriger Einreisen sowie der gesundheitspolizeilichen Identifizierung und Überwachung Erkrankter, Gefährlichkeit der Krankheit für die Gesundheitssysteme. XIV. Eine Situation wie die COVID-19-Pandemie mit den Umständen des Jahres 2020 kann als ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung und/oder der inneren Sicherheit iSv Art 25 Abs 1 VO (EU) 2016/399 eingestuft werden, sodass selbst die vorübergehende Wiederaufnahme echter Grenzkontrollen nicht ausgeschlossen erscheint. XV. Die Prüfung von COVID-19-Reiseregeln am Maßstab der RL 2004/38/EG (Unionsbürger-RL) sowie der VO (EU) 2016/399 (Schengener Grenzkodex) nimmt der EuGH nicht selbst vor, sondern überlässt sie unter Maßgabe der oben geschilderten Parameter den nationalen Gerichten.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 05.12.2023
Aufbereitet am: 15.03.2024
2944
Unionsrechtliches Daueraufenthaltsrecht steht "Daueraufenthalt - EU" nicht entgegen
Leitsätze
I. Die Antragstellung im Rahmen eines Verlängerungs- oder Zweckänderungsverfahrens ist nicht Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 45 NAG. II. § 45 Abs 11 NAG stellt auf Situationen ab, in denen ein Aufenthaltstitel "Daueraufenthalt - EU" nicht in einem Verlängerungs- oder Zweckänderungsverfahren, sondern unmittelbar anschließend an eine unionsrechtliche Aufenthaltsberechtigung erteilt wird. Weiters ist anhand von § 45 Abs 11 NAG ersichtlich, dass Aufenthaltszeiten, während derer ein Drittstaatsangehöriger über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht verfügte, als Zeiten einer rechtmäßigen Niederlassung iSd § 45 Abs 1 NAG zu betrachten sind. Den Gesetzesmaterialien zufolge hat § 45 Abs 11 NAG zudem lediglich klarstellende Funktion. III. Auch wenn aus §§ 8 und 9 NAG hervorgeht, dass der Gesetzgeber zwischen Aufenthaltstiteln und Dokumentationen unterscheiden wollte, können die §§ 8 und 9 NAG, die Art und Form von Aufenthaltstiteln und Dokumentationen regeln, sowie § 10 NAG, der Vorschriften hinsichtlich der Ungültigkeit und Gegenstandslosigkeit von Aufenthaltstiteln und Dokumentationen enthält, nicht in dem Sinn verstanden werden, dass einer lediglich zu dokumentierenden, ex lege erworbenen unionsrechtlichen Aufenthaltsberechtigung "Vorrang" gegenüber der konstitutiven Erteilung eines Aufenthaltstitels "Daueraufenthalt - EU" zukomme, weshalb die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 45 NAG nicht in Betracht zu ziehen sei. Aus dem NAG lässt sich somit nicht ableiten, dass dem Antrag eines Fremden auf Erteilung eines Aufenthaltstitels "Daueraufenthalt - EU" infolge seiner auf Art 16 Abs 2 der RL 2004/38/EG und auf den entsprechenden Bestimmungen des NAG basierenden und durch Ausstellung einer Daueraufenthaltskarte gemäß § 54a NAG dokumentierten, unionsrechtlichen Aufenthaltsberechtigung der Erfolg zu versagen wäre. IV. Drittstaatsangehörige, denen aufgrund der RL 2004/38/EG ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht zukommt, fallen in den Anwendungsbereich der RL 2003/109/EG. Auch ein richtlinienkonformes Verständnis der innerstaatlichen Rechtslage gebietet sohin, dass dem Mitbeteiligten die Erteilung eines Aufenthaltstitels "Daueraufenthalt - EU" gemäß § 45 NAG nicht deshalb verwehrt werden kann, weil er über ein unionsrechtlich begründetes Daueraufenthaltsrecht gemäß Art 16 Abs 2 der RL 2004/38/EG sowie über eine Daueraufenthaltskarte gemäß § 54a NAG verfügt.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 18.10.2023
Aufbereitet am: 14.03.2024
2943
Gesetzlich vorgesehene Alternative zur Wehrdienstverweigerung als Ausschluss einer Verfolgungsgefahr
Leitsätze
I. Die Beurteilung betreffend die Glaubhaftigkeit einer behaupteten Verfolgungsgefahr hat auf der Grundlage positiver Feststellungen zu erfolgen. Derartige positive Feststellungen können nicht getroffen werden, wenn die Angaben der fremden Person aber als unglaubwürdig erachtet werden. II. Wäre die Ableistung des Wehrdienstes mit zwangsweisen völkerrechtswidrigen Militäraktionen verbunden, so kann im Hinblick auf eine Desertation bzw Wehrdienstverweigerung bereits eine Gefängnisstrafe eine asylrelevante Verfolgung darstellen. Besteht jedoch die Möglichkeit, sich rechtsgültig durch die Leistung einer nicht unangemessen hohen Wehrersatzgebühr vom Wehrdienst zu befreien, so ist nicht vom Bestehen einer Verfolgungsgefahr auszugehen. III. Stellt die Wehrdienstverweigerung, welche die Grundlage einer behaupteten Verfolgung bildet, nicht das einzige Mittel dar, um der Beteiligung an Kriegsverbrechen zu entgehen, so kann die behauptete Verfolgung nicht als Asylgrund herangezogen werden. IV. Obwohl mehreren Anträgen auf internationalen Schutz ähnliche Sachverhalte zugrunde liegen (hier: zwei Brüder in einer ähnlichen Situation), ist dennoch jeder Fall für sich zu beurteilen und entfaltet die zuerst getroffene Entscheidung keine Bindungswirkung für das darauffolgende Verfahren. V. Die Teilnahme an einer Kundgebung gegen die Regierung im Heimatstaat (hier: Syrien) führt nicht zu einer Verfolgungsgefahr aufgrund der Annahme einer oppositionellen Gesinnung, wenn die Behörden des Heimatstaats keine Kenntnis von der Teilnahme erlangen.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 28.09.2023
Aufbereitet am: 13.03.2024
2942
Zur Prüfung eines "ernsthaften Schadens" und damit subsidiären Schutzes (Art 15 RL 2011/95/EU)
Leitsätze
I. Anträgen der vorlegenden Gerichte im Vorabentscheidungsverfahren (Art 267 AEUV), im beschleunigten Verfahren zu entscheiden (Art 105 VerfO EuGH), ist durch den Präsidenten des EuGH nicht schon aufgrund der Antragsbegründung stattzugeben, im Asylverfahren mitbetroffene Kinder seien einer starken Unsicherheit ausgesetzt. Gegen das Erfordernis eines beschleunigten Verfahrens spricht auch der Umstand, dass schon das bisherige innerstaatliche Verfahren lange gedauert hat. II. Art 15 lit b RL 2011/95/EU entspricht im Wesentlichen Art 3 EMRK. III. Alle drei Alternativen des Art 15 RL 2011/95/EU betreffend den für eine subsidiäre Schutzgewährung erforderlichen ernsthaften Schaden verlangen sowohl die Prüfung aller Umstände der allgemeinen Lage im Herkunftsland als auch der individuellen Umstände beim Antragsteller. Die drei Alternativen stehen zueinander in keinem hierarchischen oder exklusiven Verhältnis. IV. Der in Art 15 lit b RL 2011/95/EU (= Art 3 EMRK) definierte ernsthafte Schaden setzt stets eine klare Individualisierung voraus. Der geforderte Individualisierungsgrad wird nicht durch eine (noch) höhere Intensität der Gewalt im Herkunftsland herabgesetzt. V. Art 15 lit c RL 2011/95/EU ist ein autonom unionsrechtlicher Tatbestand. Er umfasst allgemeinere Gefahren. Das Erfordernis der ernsthaften, individuellen Bedrohung des Antragstellers verhält sich umgekehrt proportional zur Außergewöhnlichkeit der Situation im Herkunftsland (in Extremfällen kann es ganz entfallen).
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 09.11.2023
Aufbereitet am: 12.03.2024
2941
Versagung der Ausstellung eines Fremdenpasses vs Recht auf Ausreisefreiheit
Leitsätze
I. Verfügt die fremde Person über einen gültigen Aufenthaltstitel (hier: "Daueraufenthalt-EU") und ist daher zum unbefristeten Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt, so ist ihr ein Fremdenpass auszustellen, wenn dies im Interesse der Republik Österreich gelegen ist und es der fremden Person nicht möglich ist, bei den Vertretungsbehörden ihres Herkunftsstaats ein Reisedokument zu erhalten (§ 88 Abs 1 Z 2 FPG). II. Bei der Verweigerung der Ausstellung eines Fremdenpasses ist zu prüfen, ob dadurch ein unverhältnismäßiger Eingriff in das durch Art 2 4. ZPEMRK gewährleistete Recht auf Ausreisefreiheit erfolgt. Dh im Hinblick auf die Ausstellung eines Fremdenpasses ist eine Interessenabwägung und damit eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen. Diesfalls ist insb zu prüfen, ob es Anhaltspunkte gibt, die darauf hindeuten, dass die fremde Person den Fremdenpass für die Verwirklichung von illegalen Aktivitäten benützen würde oder durch den Aufenthalt im Ausland die innere oder äußere Sicherheit der Republik Österreich gefährdet wäre. III. Bei der Ausstellung eines Fremdenpasses ist grds ein restriktiver Maßstab anzulegen, da die Republik Österreich mit der Ausstellung dieses Dokuments der fremden Person die Möglichkeit zu reisen eröffnet und damit auch eine Verpflichtung gegenüber Gastländern übernimmt.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 06.10.2023
Aufbereitet am: 11.03.2024
2940
Zum Schulerfolgsnachweis bei modularen Ausbildungssystemen
Leitsätze
I. Unter einem Schulerfolg iSd § 63 Abs 3 NAG kann idR nur ein positives Jahreszeugnis verstanden werden. Allerdings ist für den Fall, dass einzelne Gegenstände negativ (oder vorerst nicht) beurteilt wurden, auch dann von einem Schulerfolg auszugehen, wenn ein Schüler zum Aufstieg berechtigt ist und sich auf diese Weise ohne Verzögerung der abschließenden Prüfung zu nähern vermag. Von einem Schulerfolg ist aber dann nicht auszugehen, wenn ein Schüler ein Semester wiederholt, da in einem solchen Fall von einem Aufstieg iSd VwGH-Rsp nicht die Rede sein kann. Ein Schulerfolg liegt insb auch dann nicht vor, wenn ein Schüler, für den - da er sich nach dem System der Ausbildung bereits deren Ende nähert - ein Aufstieg nicht mehr in Betracht kommt, sondern nur mehr die abschließende Prüfung vorgesehen ist, ein Semester wiederholt, anstatt die Prüfung ungesäumt abzulegen. II. Die Annahme eines Schulerfolgs setzt jedenfalls eine Berechtigung zum Aufstieg bzw am Ende der Ausbildung die Ablegung der abschließenden Prüfung voraus. Dies hat zur Folge, dass sich der Schüler auf diese Weise dem Abschluss der Ausbildung ohne Verzögerung annähern kann. Soweit die Rsp diesen Umstand besonders hervorhebt, wird kein zusätzliches (eigenständiges) Beurteilungskriterium aufgestellt, sondern bloß die genannte Folge (Wirkung) der Berechtigung zum Aufstieg bzw der abschließenden Prüfung hervorgekehrt. III. Der Telos des SchUG-BKV besteht nicht darin, von berufstätigen bzw erwachsenen Schülern weniger Schulerfolg zu verlangen, sondern darin, einen Erfolg nur nicht in der (für Schüler an dem SchUG unterliegenden Schulen maßgeblichen) kontinuierlichen Weise zu verlangen. IV. Bei der Prüfung gemäß § 63 Abs 3 NAG ist das Vorliegen eines Schulerfolgs zwar in einem bestimmten (zuletzt abgeschlossenen) Schuljahr zu beurteilen. Dies ändert aber nichts daran, dass die für die Beurteilung des Schulerfolgs nach dem hier maßgeblichen SchUG-BKV entscheidende Frage, ob sich ein Schüler dem Abschluss der Ausbildung ohne Verzögerung annähert und damit ein Abschluss der Ausbildung innerhalb der vorgesehenen Ausbildungsdauer möglich ist, zwangsläufig einen Bezug zur vorgesehenen Gesamtdauer der Ausbildung aufweist. V. Die Beurteilung des Schulerfolgs iSe verzögerungsfreien Annäherung an den Abschluss der Ausbildung bestimmt sich mangels eigenständiger Regelungen im NAG anhand der einschlägigen schulunterrichtsrechtlichen Normen - hier dem SchUG-BKV. Das SchUG-BKV setzt jedoch (ua) eine Berechtigung zum Aufstieg voraus. Kommt eine solche nicht mehr in Betracht, ist im Hinblick darauf aber jedenfalls vom Fehlen des erforderlichen Studienerfolgs auszugehen.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 06.09.2023
Aufbereitet am: 08.03.2024
2939
Rückkehrentscheidung niemals während offener erstinstanzlicher Asylverfahren
Leitsätze
I. Das vorübergehende Aufenthaltsrecht von Asylwerbern iSd Art 9 Abs 1 RL 2013/32/EU schließt die Anwendbarkeit der RL 2008/115/EG (RückführungsRL) bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Asylverfahrens aus. II. Die Erlassung einer Rückkehrentscheidung vor dem erstinstanzlichen Asylverfahrensabschluss ist daher in Ermangelung eines illegalen Aufenthalts (vgl Art 2 Abs 1, Art 3 Z 2 und Art 6 RL 2008/115/EG) stets rechtswidrig, egal, auf welchen Zeitraum in der Rückkehrentscheidung Bezug genommen wird.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 09.11.2023
Aufbereitet am: 07.03.2024
2938
Scheinarbeitsverhältnis begründet kein Freizügigkeitsrecht
Leitsätze
Nicht jede auch noch so geringfügige Ausübung des Freizügigkeitsrechts entfaltet Relevanz. Vielmehr ist es erforderlich, dass mit einer gewissen Nachhaltigkeit von der Freizügigkeit Gebrauch gemacht wird. Was die Festlegung der Nachhaltigkeitsgrenze anlangt, liegt es nahe, auf die Rsp des EuGH zum Arbeitnehmerbegriff abzustellen. Der EuGH verlangt für die Qualifikation als Arbeitnehmer iSv Art 45 AEUV jenseits des Erfordernisses einer abhängigen Beschäftigung gegen Entgelt in einem anderen Mitgliedstaat einschränkend eine "tatsächliche und echte Tätigkeit", die keinen so geringen Umfang hat, dass es sich um eine "völlig untergeordnete und unwesentliche Tätigkeit" handelt. Dieser Maßstab lässt sich allgemein dergestalt auf alle Freizügigkeitsrechte übertragen, dass eine "tatsächliche und effektive" Ausübung derselben vorliegen muss. In seiner Rsp zum Arbeitnehmerbegriff hat der EuGH zum Ausdruck gebracht, dass die Höhe der Vergütung, die der Arbeitnehmer erhält, ebenso wenig von alleiniger Bedeutung ist wie das Ausmaß der Arbeitszeit und die Dauer des Dienstverhältnisses.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 19.09.2023
Aufbereitet am: 06.03.2024
2937
Neuerlich zum Nachweis eines Krankenversicherungsschutzes
Leitsätze
Gemäß dem eindeutigen Wortlaut von § 11 Abs 2 Z 3 NAG iVm § 7 Abs 1 Z 5 NAG-DV kann der bloße Verweis auf einen beabsichtigten Versicherungsabschluss nach Einreise nach Österreich die Nachweispflicht nicht substituieren. Auch die für Studierende bestehende Möglichkeit der Selbstversicherung gemäß § 16 Abs 2 ASVG ändert daran nichts, solange nicht tatsächlich ein ausreichender Krankenversicherungsschutz für die gesamte Dauer des Aufenthalts abgeschlossen wurde.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 12.09.2023
Aufbereitet am: 05.03.2024
2936
Unzureichende Ermittlungen zur Rückkehrsituation von aus der Ukraine stammenden russischen Staatsangehörigen
Leitsätze
Eine mündliche Verhandlung kann nur unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 25.10.2023
Aufbereitet am: 04.03.2024
2935
Auch im Fall einer Amtsrevision keine Klärung abstrakt-theoretischer Rechtsfragen durch den VwGH
Leitsätze
I. Ein Einstellungsfall wegen Gegenstandslosigkeit gemäß § 33 Abs 1 VwGG liegt insb auch dann vor, wenn der Revisionswerber - infolge Änderung maßgeblicher Umstände - kein rechtliches Interesse mehr an einer Sachentscheidung hat und somit materiell klaglos gestellt wurde. Dies gilt auch für Fälle einer Amtsrevision. II. Ein Rechtsschutzinteresse ist immer dann zu verneinen, wenn es (aufgrund der geänderten Umstände) für die Rechtsstellung des Revisionswerbers keinen Unterschied mehr macht, ob die angefochtene Entscheidung aufrecht bleibt oder aufgehoben wird, bzw wenn die Erreichung des Verfahrenszieles für ihn keinen objektiven Nutzen hat, die in der Revision aufgeworfenen Rechtsfragen somit insoweit nur (mehr) theoretische Bedeutung haben. Der VwGH ist nicht zu einer abstrakten Prüfung der Rechtmäßigkeit einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung berufen. Dies gilt auch für Fälle einer Amtsrevision.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 12.09.2023
Aufbereitet am: 01.03.2024
2934
Neuerlich zur Wiederaufnahme von Aufenthaltstitelverfahren und zur verwaltungsgerichtlichen Entscheidungsbefugnis
Leitsätze
I. Bei amtswegigen Wiederaufnahmen mehrerer Verfahren und den anschließenden Entscheidungen über die betreffenden Anträge handelt es sich um voneinander trennbare Spruchpunkte. Liegen trennbare Absprüche vor, so ist auch die Zulässigkeit der Revision getrennt zu prüfen. II. Nach stRsp des VwGH ist "Sache" des Beschwerdeverfahrens vor dem VwG nur jene Angelegenheit, die den Inhalt des bescheidmäßigen Spruchs der belangten Behörde gebildet hat. Der äußerste Rahmen für die Prüfbefugnis des VwG ist daher die "Sache" des bekämpften Bescheids; entscheidet das VwG in einer Angelegenheit, die noch nicht oder nicht in der vom VwG in Aussicht genommenen rechtlichen Art Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war, erstmals in Form eines Erkenntnisses, so fällt eine solche Entscheidung nicht in die funktionelle Zuständigkeit des VwG und ist mit Rechtswidrigkeit infolge Unzuständigkeit belastet. III. Der Wiederaufnahmegrund des § 69 Abs 1 Z 1 AVG ist, soweit der Bescheid durch gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt wurde, unabhängig davon erfüllt, ob die eine Wiederaufnahme des Verfahrens rechtfertigende gerichtlich strafbare Handlung von der dadurch begünstigten Partei gesetzt oder veranlasst wurde, oder ob sie zumindest davon Kenntnis hatte. Es kommt nicht darauf an, ob und gegebenenfalls welche Rolle die begünstigte Partei bei der strafbaren Handlung gespielt hat. IV. IZm Wiederaufnahmeverfahren betreffend die Erteilung von Aufenthaltstiteln geht es nicht darum, den Kindern das Eingehen einer Aufenthaltsehe durch einen Elternteil anzulasten, sondern darum, ob ihnen ein Erschleichen des Bescheids durch den Elternteil (im Wege des Berufens auf eine Aufenthaltsehe) zugerechnet werden kann. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn die erteilten Aufenthaltstitel vom gesetzlichen Vertreter erwirkt wurden, sodass sein Verschweigen der Aufenthaltsehe als "Erschleichen" iSd § 69 Abs 1 Z 1 AVG in den Verfahren der Kinder gewertet und diesen zugerechnet werden kann.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 19.09.2023
Aufbereitet am: 29.02.2024
2933
Berücksichtigung des Kindeswohls
Leitsätze
Infolge der fehlenden Auseinandersetzung mit den aktuellen Umständen, dem Aufenthaltstitel "Daueraufenthalt-EU" der Ehefrau, der Beziehung zu seinem Sohn und den Auswirkungen einer Übersiedlung der gesamten Familie auf das Kindeswohl, wird der Beschwerdeführer im Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens verletzt.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 19.09.2023
Aufbereitet am: 28.02.2024
2932
Zu den Kriterien für einen Schutz von Palästinensern ipso facto nach der Status-RL
Leitsätze
I. Gemäß Art 12 Abs 1 lit a zweiter Satz RL 2011/95/EU genießen Personen ipso facto den Schutz dieser RL, wenn ein zuvor bestehender (vom Flüchtlingsschutz ausschließender [Art 1 Abschnitt D Abs 1 GFK]) Schutz oder Beistand einer UN-Institution bzw -Organisation, insb des UNRWA, nicht mehr gewährt wird. II. Ein Ende der Schutzgewährung einer UN-Institution bzw -Organisation kann nicht nur durch einen dahingehenden Willensakt oder eine Auflösung zustande kommen, sondern auch durch eine faktische Verunmöglichung der Aufgabenwahrnehmung. III. Ein Ende der Schutzgewährung durch das UNRWA ist nicht schon darin zu erblicken, dass die Versorgungslage, insb in medizinischer Hinsicht, in der EU im Allgemeinen besser ist als im UNRWA-Einsatzgebiet. Vielmehr kommt es auf eine Unmöglichkeit an, seitens der Institution bzw Organisation die für den Gesundheitszustand erforderliche Versorgung bereitgestellt zu bekommen, sodass eine tatsächliche unmittelbare Lebensgefahr oder die tatsächliche Gefahr einer ernsten, raschen und irreversiblen Verschlechterung des Gesundheitszustands oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung besteht.
Lesen Sie mehr (vorher anmelden)
Entscheidungsdatum: 05.10.2023
Aufbereitet am: 27.02.2024